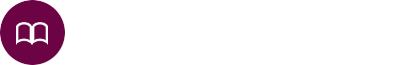Juristen diskutieren seit Langem über die rechtlichen Herausforderungen bei der Implementierung von Künstlicher Intelligenz. In diesem Kapitel soll es um die betroffenen Rechtsnormen gehen, um Fragen von Urheberrecht und Patentschutz, um den rechtlichen Charakter der Regulierung durch den EU AI Act und zu erwartende, künftige Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen. Denn zumindest aus der Politik und seitens Lobbyisten wurde in den letzten Monaten immer wieder beklagt, dass beispielsweise das geltende Urheberrecht Innovationen ausbremst. Zudem ist es durchaus spannend, wie sich die Rechtsprechung selbst, die Arbeit von Rechtsanwälten, Staatsanwaltschaften und Gerichten, verändern wird. Die folgenden Ausführungen sind eine journalistische Aufarbeitung und stellen keine Rechtsberatung dar.
Die drei häufigsten Fragen drehen sich um mögliche Rechte und Verantwortlichkeiten der Künstlichen Intelligenz. Die Fragen sind durchaus berechtigt, wenn man zum einen an die generative KI denkt, die sich als Texter, Grafiker, bild- und Videogenerator sowie Komponist und Musiker präsentiert, und andererseits an KI-Lösungen, die Grundlagen und Empfehlungen für Entscheidungen liefern, die Interessen und Rechte von Bürgern oder Unternehmen betreffen, oder gar künftig selbst diese Entscheidungen treffen könnten. Grundsätzlich kann die KI selbst keine Rechte proklamieren, da sie keine natürliche oder juristische Person ist. Vielmehr ist derjenige - die Person, das Unternehmen oder die Institution -, welche die Künstliche Intelligenz betreibt, einsetzt oder kontrolliert, verantwortlich und nimmt Rechte und Pflichten wahr. Dies hat Relevanz bei Fragen zur Haftung oder zum Datenschutz. Im Kontext des Urheberrechtsgesetzes oder bei Fragen zur Patentfähigkeit von durch die KI generierten Werken, stellt sich aber zudem die Frage nach einer persönlichen Schöpfungshöhe. Diese kann eine KI regelmäßig nicht reklamieren. Im Einzelfall höchstens ihr Nutzer, wenn der Beitrag der KI lediglich einen geringeren Anteil an der Werkschöpfung hat und umgekehrt der Mensch - trotz Nutzung der Künstlichen Intelligenz als Werkzeug – eine eindeutige persönliche, geistige Schöpfung erbracht hat. Dazu gehört nach übereinstimmender (...)
Juristen diskutieren seit Langem über die rechtlichen Herausforderungen bei der Implementierung von Künstlicher Intelligenz. In diesem Kapitel soll es um die betroffenen Rechtsnormen gehen, um Fragen von Urheberrecht und Patentschutz, um den rechtlichen Charakter der Regulierung durch den EU AI Act und zu erwartende, künftige Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen. Denn zumindest aus der Politik und seitens Lobbyisten wurde in den letzten Monaten immer wieder beklagt, dass beispielsweise das geltende Urheberrecht Innovationen ausbremst. Zudem ist es durchaus spannend, wie sich die Rechtsprechung selbst, die Arbeit von Rechtsanwälten, Staatsanwaltschaften und Gerichten, verändern wird. Die folgenden Ausführungen sind eine journalistische Aufarbeitung und stellen keine Rechtsberatung dar.
Die drei häufigsten Fragen drehen sich um mögliche Rechte und Verantwortlichkeiten der Künstlichen Intelligenz. Die Fragen sind durchaus berechtigt, wenn man zum einen an die generative KI denkt, die sich als Texter, Grafiker, bild- und Videogenerator sowie Komponist und Musiker präsentiert, und andererseits an KI-Lösungen, die Grundlagen und Empfehlungen für Entscheidungen liefern, die Interessen und Rechte von Bürgern oder Unternehmen betreffen, oder gar künftig selbst diese Entscheidungen treffen könnten. Grundsätzlich kann die KI selbst keine Rechte proklamieren, da sie keine natürliche oder juristische Person ist. Vielmehr ist derjenige - die Person, das Unternehmen oder die Institution -, welche die Künstliche Intelligenz betreibt, einsetzt oder kontrolliert, verantwortlich und nimmt Rechte und Pflichten wahr. Dies hat Relevanz bei Fragen zur Haftung oder zum Datenschutz. Im Kontext des Urheberrechtsgesetzes oder bei Fragen zur Patentfähigkeit von durch die KI generierten Werken, stellt sich aber zudem die Frage nach einer persönlichen Schöpfungshöhe. Diese kann eine KI regelmäßig nicht reklamieren. Im Einzelfall höchstens ihr Nutzer, wenn der Beitrag der KI lediglich einen geringeren Anteil an der Werkschöpfung hat und umgekehrt der Mensch - trotz Nutzung der Künstlichen Intelligenz als Werkzeug – eine eindeutige persönliche, geistige Schöpfungerbracht hat. Dazu gehört nach übereinstimmender (...)
Oliver Schwartz
Oliver Schwartz ist Experte für strategische Kommunikation mit mehr als 25 Jahren Erfahrung als Manager in internationalen Technologieunternehmen. Seine Expertise bringt er heute in Beratungsmandate mit Unternehmen, Vorständen und GeschäftsführerInnen und als Interimsmanager ein. Wissen und Impulse rund um KI in Business und Gesellschaft teilt er in Veröffentlichungen, als Autor, Vortrags-Redner und als Podcaster.
Dr. Michael Gebert
Dr. Michael Gebert ist visionärer Unternehmer und international gefragter Keynote-Sprecher. Er blickt auf 30 Jahre strategisches Denken und innovatives Handeln zurück. Als Positivist mit solidem betriebswirtschaftlichen Hintergrund und einer Promotion in Schwarmintelligenz, beschäftigt er sich leidenschaftlich mit ethisch akzeptablen Einsatz von KI-Innovationen und dezentralen Strukturen im Unternehmensumfeld.
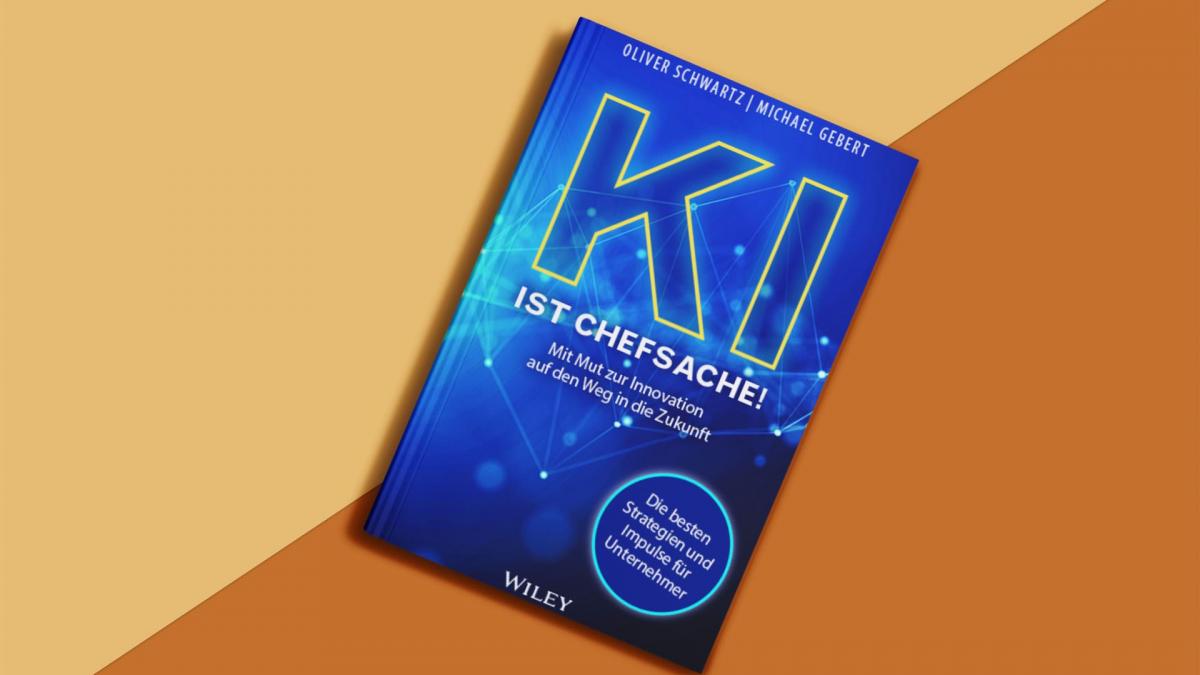
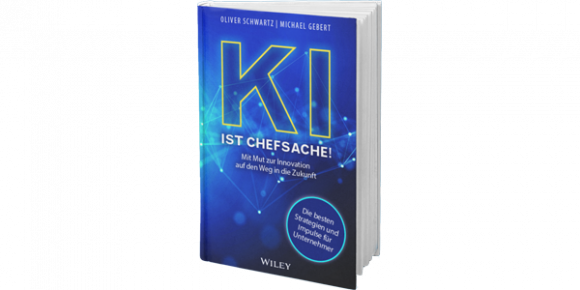


 Neuerscheinung!
Neuerscheinung!